
Der Nervenzusammenbruch umschreibt einen für Betroffene äußerst belastenden Zustand. Er zählt zu den posttraumatischen Belastungsstörungen und lässt Laien aufgrund seines Namens oftmals glauben, es handle sich um eine Störung des Nervensystems. Tatsächlich beschreibt der Nervenzusammenbruch aber eine psychische Störung, deren Symptome nicht selten aus emotionalen Überreaktionen bestehen. Eine Eigenschaft, in der Nervenzusammenbrüche einer Depression sehr ähnlich sind. Allerdings tritt der Zusammenbruch eher kurzfristig auf, während eine Depression über längere Zeiträume anhalten kann. Weitere Einzelheiten zu Ursachen und Charakter eines Nervenzusammenbruchs, sowie zu möglichen Arten der Behandlung präsentieren wir in diesem Ratgeber.
Wie entsteht ein Nervenzusammenbruch?
Der Begriff Nervenzusammenbruch ist sehr irreführend ist, denn es handelt sich bei der Belastungsstörung weder um ein Versagen noch eine Schädigung des Nervensystems. Vielmehr ist der Nervenzusammenbruch als Höhepunkt einer psychischen bzw. seelischen Krise (z.B. Identitätskrise, Glaubenskrise oder Lebenskrise) zu verstehen. Eine mentale und emotionale Stressspitze also.
Patienten, die einen Nervenzusammenbruch erleiden, finden oft kein Mittel zur Bewältigung ihrer Lebenskrise oder Identitätskrise. Der so entstehende, psychische und seelische Konflikt macht sich durch Körperreaktionen und ein Verhalten bemerkbar, wie sie auch für eine Depression üblich sind. Hierzu zählen zum Beispiel Weinkrämpfe, emotionale Verstimmungen und Kopfschmerzen. Auch tritt der Nervenzusammenbruch nicht selten als Vorbote einer Depression auf, was die Ähnlichkeit beider psychischen Störungen weiter unterstreicht.
Ursachen eines Nervenzusammenbruchs
Wie bereits aufgezeigt, liegt der Nervenzusammenbruch in einem belastenden Ausnahmezustand begründet. In Bezug auf die Ursachen ähneln die Zusammenbrüche abermals der Depression. Diese kann mitunter zwar auch durch genetische Veranlagung, hormonelle oder medikamentöse Einflüsse entstehen. Stress und traumatische Erlebnisse sind jedoch deutlich häufiger die Grundlage depressiver Verstimmungen. Gleiches gilt auch für den Nervenzusammenbruch, der nu auf stressreiche oder traumatische Situationen zurück zu führen ist. Welche Situationen hier im Einzelnen in Frage kommen, sehen Sie in der folgenden Übersicht:
Alltagsstress und Burnout: Stress im Alltag ist heute die häufigste Ursache für einen Nervenzusammenbruch. Da der Organismus bei anhaltender Belastung durch Stress nicht mehr zur Ruhe kommt, steht das körperliche Bedürfnis nach Erholung irgendwann im Konflikt mit dem psychischen Leistungsdrang (oder Leistungszwang). Wer diesen Konflikt nicht bald durch ausreichende Maßnahmen zur Entspannung beendet, der läuft Gefahr, einen Nervenzusammenbruch zu riskieren. Hierbei ist die Belastungsstörung auch häufig ein Anzeichen für Burnout.
Unfalltraumata: Traumatische Unfälle sind für gewöhnlich mit einem enormen Schock für Betroffene verbunden. Ein Nervenzusammenbruch ist in derartigen Situationen keine Seltenheit. Es fehlt den meisten an geeigneten Strategien, die schockierenden Eindrücke zu verarbeiten. Dies gilt vor allem dann, wenn der Unfall mit schweren Verletzungen oder gar Unfalltoten in Verbindung steht. Sofern der Unfall einen Verlust körperlicher Fähigkeiten (z.B. Gehen, Sprechen oder Sehen) zur Folge hatte, begünstigt er zudem die Entstehung einer handfesten Lebenskrise. Immerhin müssen sich Patienten in solch einer Situation auf eine dauerhafte Änderung ihres alltäglichen Ablaufs einstellen. Geeignete Mechanismen zur Bewältigung zu erlernen oder sich überhaupt mit der Umstellung abzufinden, fällt vielen gerade zu Beginn sehr schwer.
Gewalttraumata: Körperliche Gewalt begünstigt bei Opfern eine Vielzahl psychischer und seelischer Störungen. Neben einem Nervenzusammenbruch sind hier auch tiefgreifende Kommunikations-, Empfindungs- und Verhaltensstörungen, sowie eine chronische Depression denkbar. In Extremfällen treten psychische und seelische Störungen dabei auch gemeinsam auf, sodass eine Abgrenzung äußerst schwierig wird.
Todesfälle: Der Verlust einer geliebten Person löst bei Menschen ebenfalls starke Krisen und Schockzustände aus. Das Schwinden eines gewohnten Sozialkontaktes kann von Betroffenen oft nicht sofort akzeptiert werden. Auch hier fehlt zunächst ein geeigneter Mechanismus, um mit dem Verlust umgehen zu können. Dies löst als Folge mitunter eine posttraumatische Belastungsstörung aus. Handelt es sich bei dem Verstorbenen gar um eine wichtige Bezugsperson (z.B. Elternteil oder Ehepartner), droht gar eine Lebenskrise oder Identitätskrise. Darüber hinaus seien auch Nahtoderfahrungen, Kriegserlebnisse mit Todesfällen und der Verlust eines ungeborenen Kindes als mögliche Auslöser von Nervenzusammenbrüchen erwähnt.
Katastrophen: Naturkatastrophen besitzen ob ihrer gewaltigen Kraft durchaus einen traumatisierenden Effekt auf die menschliche Psyche. Personen, die Zeugen einer solchen Katastrophe werden, werden sich zum Zeitpunkt des Erlebnisses oft erstmals ihrer eigenen Machtlosigkeit bewusst. Ähnlich sieht es bei Zivilisationskatastrophen, zum Beispiel in Form von Terroranschlägen, Bombenangriffen oder atomaren Supergaus aus. Dass Nervenzusammenbrüche den Beginn einer Depression ankündigen, ist bei Katastrophen ebenfalls möglich.
Phobien: Eine Angststörung entwickelt sich häufig im Zuge eines Schlüsselereignisses mit posttraumatischem Belastungspotential. Bestes Beispiel ist hier die Angst vor Spinnen (Arachnophobie). Betroffene haben die Phobie häufig schon im Kindesalter entwickelt, wobei die kindliche Panik vor den Insekten bis ins Erwachsenenalter hinein ein prägender Eindruck bleibt. Sobald die Phobiker wiederholt mit einer Spinne konfrontiert werden, steigt die übertriebene Angst aus Kindertagen wieder in ihnen auf. Dies steht im klaren Kontrast zum vernunftgeprägten Verhalten eines Erwachsenen. Der Nervenzusammenbruch ist in diesem Fall abermals Ausdruck fehlender Strategien zur Bewältigung in Bezug auf die kindlichen Erinnerungen. Gleiches gilt auch für andere Formen der Angststörung, so zum Beispiel Prüfungsangst oder Sozialphobie.
Symptome bei Nervenzusammenbruch

Die Symptome eines Nervenzusammenbruchs können sehr verschieden sein. Von emotionalen Überreaktionen und Verhaltensstörungen über Probleme mit der Verdauung bis hin zu Herz-Kreislauf-Problemen kommen hier diverse Beschwerden in Betracht. Manche Symptome lassen jedoch einen Rückschluss auf die vorherigen, belastenden Erlebnisse zu, wie folgende Übersicht zeigt:
- Antriebslosigkeit (v.a. bei Burnout)
- Benommenheit und Teilnahmslosigkeit
- depressive Verstimmungen (v.a. bei beginnender Depression)
- extreme Frustration oder Verzweiflung
- extreme Wut oder Trauer (v.a. bei Unfalltraumata und Todesfällen)
- Herzrasen und Herzklopfen
- Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen
- körperliche, psychische oder seelische Erschöpfung
- Nervosität und innere Unruhe
- Panikattacken
- Schlafstörungen
- Schweißausbrüche (v.a. bei Angststörungen)
- Übelkeit
- Verdauungsprobleme
- Weinkrämpfe
- Zittern
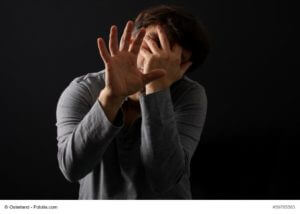
Diagnose und Therapie bei Nervenzusammenbruch
Da ein Nervenzusammenbruch psychische bzw. seelische Ursachen hat, sollte er von einem Psychotherapeuten in Augenschein genommen werden. Essenziell für die Diagnose ist hierbei ein Patientengespräch zur Abklärung möglicher Belastungen und traumatischer Erlebnisse. Ergänzend ist jedoch auch eine körperliche Untersuchung, beispielsweise durch EKG und Bluttests ratsam, um körperliche Beschwerden wie Herzrasen oder Verdauungsbeschwerden feststellen zu können. Zur Behandlung des Nervenzusammenbruchs bieten sich dann folgende Maßnahmen an:
Gesprächs- und Verhaltenstherapie: Zur Aufarbeitung der belastenden Erlebnisse, ebenso wie zum Erlernen geeigneter Strategien zur Bewältigung für die Zukunft, ist eine Psychotherapie nötig. Im Rahmen einer Gesprächstherapie lässt sich so manches Trauma von der Seele reden. In Kombination mit einer Verhaltenstherapie können sich Patienten dann geeignete Mechanismen aneignen, die eine erneute Krise verhindern. Bei Burnout bietet sich zudem eine Entspannungstherapie an. Diese kann unter anderem Mediationskurs, Yoga oder Maßnahmen zur Angstbewältigung enthalten.
Bewegungstherapie: Ein Spaziergang kann so manche seelische Beklemmung lindern. Überhaupt sind Bewegung und Aufenthalte im Grünen ein gutes Mittel gegen Belastungsstörungen und Depression. Denn wer den ganzen Tag zu Hause grübelt, den suchen belastende Gedanken umso schneller heim. Suchen Sie bei einem Nervenzusammenbruch deshalb gezielt Zuflucht in der Natur und betreiben Sie regelmäßig angenehme Sportarten wie Schwimmen oder Fahrradfahren.
Ernährungstherapie: Damit Körper und Geist wieder gestärkt werden, ist natürlich auch eine gesunde Ernährung wichtig. Verzichten Sie auf Unruhe fördernde Lebensmittel wie Kaffee, Energydrinks oder zuckerhaltige Produkte. Greifen Sie stattdessen lieber zu vitaminreicher Kost wie Obst oder Gemüse. Auch von Alkohol sollten Sie die bei posttraumatischen Belastungsstörungen die Finger lassen. Spirituosen sind der geistigen und seelischen Verfassung alles andere als zuträglich. Darüber hinaus sind Menschen, die an einer Depression, Burnout oder einem Nervenzusammenbruch leiden, stark suchtgefährdet.
medikamentöse Therapie: Wer im Zuge eines Nervenzusammenbruchs an Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen oder einer ausgewachsenen Depression leidet, der ist womöglich auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Neben Schmerzmitteln kommen hier vor allem Beruhigungsmittel aus dem Bereich der Sedativa und Antidepressiva zum Einsatz. Vor allem Tranquilizer mit Wirkstoffen aus der Gruppe der Benzodiazepine werden bei Belastungsstörungen häufig angewandt. Passende Medikamente sind zum Beispiel Diazepam, Alprazolam oder Lorazepam. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass Beruhigungsmittel oft einen hohen Suchtfaktor aufweisen. Halten Sie sich bei der Dosierung deshalb unbedingt an die Empfehlungen Ihres Arztes.
heilpflanzliche Mittel: Kräuter mit beruhigender Wirkung leisten bei Belastungsstörungen gute Hilfe und bieten manchmal sogar eine echte Alternative zu aggressiven Pharmazeutika mit hohem Suchtpotential. Zu empfehlen sind hier vor allem Präparate aus Baldrian, Hopfen, Lavendel, Melisse, Passionsblume und Sternanis. Ob als Tee, in Tabletten- oder Tropfenform. Das Angebot heilpflanzlicher Mittel ist groß und bietet für jedes Problem eine geeignete Variante.
Schlafhygiene und Alltagsplanung: Ein ausgeglichener Alltag sowie feste Schlafzeiten sind nicht nur für Patienten mit Burnout wichtig. Auch ein Nervenzusammenbruch lässt sich leichter behandeln, wenn Schlaf- und Alltagsgewohnheiten einem ruhigen, stressfreien Konzept folgen. Vermeiden Sie deshalb jegliche psychische und seelische Anstrengung bis ihr Zusammenbruch komplett abgeklungen ist. Danach sollte die harmonische Balance zwischen Leistung und Ruhe zum Standard werden, um einem Rückfall vorzubeugen.
Nervenzusammenbruch – Verlauf, Komplikationen und Prävention

- Zusammenbrüche nehmen einen sehr individuellen Verlauf. Dieser ist grundsätzlich vom Ausmaß der Belastung, sowie den Fortschritten bei deren Verarbeitung abhängig. Flashbacks und Rückfälle sind vor allem nach gravierenden Schockzuständen trotz erfolgreicher Bewältigung nicht ausgeschlossen. Konsequente Eigenmotivation und nachhaltige Alltags- bzw. Verhaltensumstellungen können das Risiko eines wiederholten Auftretens der Zusammenbrüche jedoch erfolgreich reduzieren.
- Komplikationen treten bei Nervenzusammenbrüchen maßgeblich durch Begleitstörungen (z.B. Depressionen oder Burnout) und unvollständige Traumabewältigung während der Therapie auf. Des Weiteren erschweren Verdrängungsmechanismen und Abwehrhaltungen des Patienten gelegentlich die Behandlung.
- Vorbeugen lässt sich einem Nervenzusammenbruch nur dann, wenn er auf Ursachen beruht, die von Betroffenen selbst beeinflusst werden können. Burnout, Stress und einige Formen von Angststörungen sind deshalb die einzigen Gründe, die sich vorab durch Vermeidung oder Verhaltenstraining verhindern lassen. Unfälle, Gewalttraumata und Katastrophenszenarien machen eine Prävention dagegen nahezu unmöglich. Die einzige Option zur Vorbeugung ist es hier, entsprechendes Gefahrenpotential durch Vorsicht zu umgehen.
Fazit
Unter den psychischen Störungen ist der Nervenzusammenbruch das deutlichste Warnsignal für eine umfassende mentale und seelische Überlastung. In den meisten Fällen ist anhaltender Stress oder ein einprägsames Trauma für den Zusammenbruch verantwortlich. Entgegen weitläufiger Vermutungen hat die Belastungsstörung aber nichts mit Nervenversagen zu tun, sondern gibt einen geistigen wie emotionalen Ausnahmezustand wieder, zu dessen Auflösung dem Betroffenen keine geeignete Bewältigungsstrategie zur Verfügung steht. Für die Behandlung von Nervenzusammenbrüchen sind deshalb vor allem Gesprächs- und Verhaltenstherapien notwendig. Nur durch sie kann ein Patient erlernen, künftig angemessen auf Ausnahmezustände zu reagieren und so einen Nervenzusammenbruch zu verhindern.







